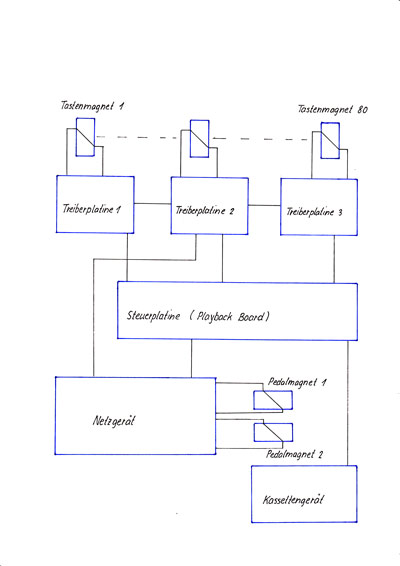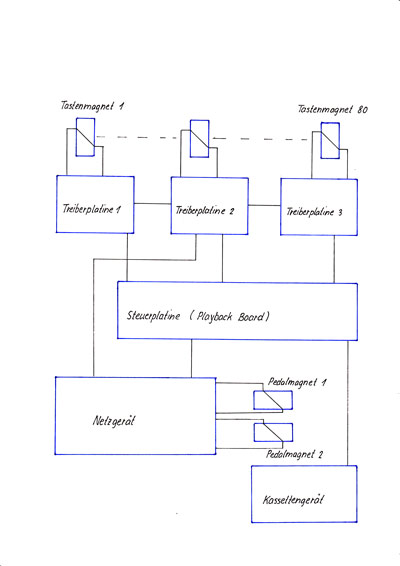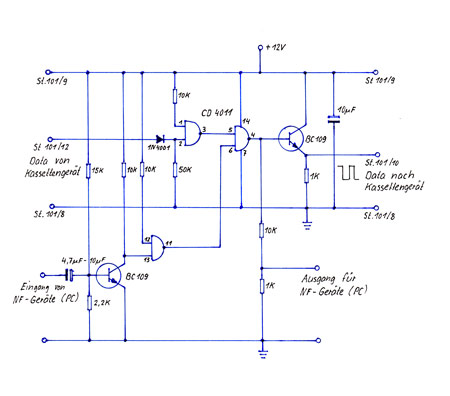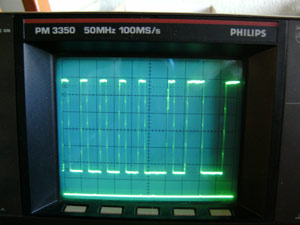Marantz-Pianocorder
Systembeschreibung
Nachdem im letzten Beitrag der Bau eines Pianocorder
Vorsetzers beschrieben wurde, vermitteln folgende Zeilen die Funktion
und meine (noch jungen) Erfahrungen über das Kassettengerät,
die Bänder und MIDI.
Die Funktion
Zu Beginn möchte ich gleich festhalten, dass das Pianocordersystem
auch eine Aufnahmemöglichkeit bietet. Diese Einrichtung ist bei
mir nicht vorhanden, da ich erstens nicht Klavier spielen kann und man
zweitens heute ein nuanciertes Spiel mit modernen Keyboards aufzeichnen
kann, was die Aufnahmemöglichkeiten eines Pianocorders
übertrifft. In diesem Beitrag wird das Aufnahmesystem also nicht
beschrieben. Aus dem Blockschaltbild geht hervor, dass die 80
Tastenmagnete von drei Treiberplatinen angesteuert werden. Pro
Treiberplatine sind die Adressbausteine und pro Tastenmagnet ein
Leistungstransistor vorhanden. Die Steuerplatine decodiert die Signale
des Kassettengerätes und sendet die decodierten Signale an die
Treiberplatinen weiter. Auch steuert sie über Adressbausteine via
das Netzgerät die Pedalmagnete an. Zu erwähnen ist, dass es
sich hier nicht um eine computergesteuerte Elektronik handelt, sondern
um eine Echtzeitaufnahme der Signale auf ein Kassettenband. Lässt
man das Band also langsamer laufen, so spielt das Klavier auch
langsamer wie wenn man die Rolle im Klavier langsamer spielen
lässt. Anstelle der Löcher im Papier sind hier einfach
Signale auf dem Band. Das Netzgerät liefert die Niederspannungen
für die digitalen Bausteine und die 170 Volt Gleichspannung
für die Magnete, wobei dafür die in Amerika
gebräuchliche 110 Volt Netzspannung ohne Transformator
direkt gleichgerichtet wird. Da bei uns aber 220/230 Volt üblich
sind, muss sowieso ein Transformator davor geschaltet werden und
dadurch wird das Hantieren etwas ungefährlicher. Aufpassen muss
man nur, dass man keinen Autotrafo erwischt, dieser wäre dann
nicht galvanisch getrennt! Die Tastenmagnete werden mit 200 Hz Impulsen
angesteuert. Kurze Impulse und lange Impulspausen ergeben dadurch einen
leisen Anschlag, lange Impulse und kurze Impulspausen ergeben einen
lauten Anschlag. Auch die Pedalmagnete werden auf diese Art gesteuert,
wobei die Druckstärke mit einem Regler einreguliert werden kann
und bleibt dann immer gleich.
Kassettengerät
Das Kassettengerät läuft mit doppelter Geschwindigkeit als
üblich, also mit 9.5 cm pro Sekunde. Verwendet werden 90 Minuten
Bänder das ergibt nur 45 Minuten Spieldauer. Mit einem Regler kann
die Abspielgeschwindigkeit verstellt werden. Auch die
Grundlautstärke kann eingestellt werden ebenso wie leise das
Klavier spielen soll bei piano Passagen. Ein Schalter um das linke
Pedal auszuschalten ist auch vorhanden. Neben dem Kassettenfach
ist ein Rädchen montiert mit welchem der Tonkopf in einem gewissen
Bereich in der Höhe verstellt werden kann. Man sieht also, dass
das System schon gewisse Anforderungen an die
Uebertragungsqualität stellt. Die decodierten Signale sind auf dem
Band mit zwei Frequenzen 2.25 Kiloherz und 4.5 kHz aufgezeichnet. Das
ist eigentlich nicht mehr als ein gewöhnlicher Telefonapparat
überträgt. Aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, ob
man diese Bänder nicht auf den PC laden und im mp3 Format
abspeichern könnte, damit weniger Speicherplatz benötigt
wird. Dies als Sicherung, da die Qualität der Aufzeichnungen mit
der Alterung der Bänder abnimmt. Leider hat dieser Versuch
fehlgeschlagen. Aufnehmen hat funktioniert, aber nach der Konvertierung
gab es „Misstöne“. Beim genaueren Betrachten hat sich
herauskristallisiert, dass das Problem beim Uebergang der 2.25 kHz
Frequenz zum 4.5 kHz Ton liegt. Dieser Uebergang muss genau abgebildet
sein, damit das Kassettengerät daraus schöne Rechteckimpulse
erzeugen kann (Bild Oszillogramm).
MIDI und Kassetten
Unser Mitglied, Fred Gerer, hat mich auf die Homepage von Mark Fontana,
www.pianocorder.info, aufmerksam gemacht. Das ist nun eine wahre
Fundgrube was MIDI anbelangt. Dort findet man tausende Files von
eingescannten Welte-, Ampico-, 88er- und anderen Rollen, sowie weiteren
MIDI-Files. Mark Fontana hat auch ein Computerprogramm entwickelt mit
welchem diese MIDI-Files auf dem Pianocorder abgespielt werden
können mittels einer Adapter-Kassette.

Diese Kassette kann für wenig Geld in einem Elektronikshop
erworben werden. Darin enthalten ist lediglich ein Tonkopf. Legt man
sie in den Recorder ein, so ist Tonkopf auf Tonkopf und die Signale
werden induktiv übertragen. Das Anschlusskabel dieser
Adapter-Kassette wird am PC Line Ausgang eingesteckt. Ich habe dies
ausprobiert und es hat auf Anhieb funktioniert inkl. Pedalsteuerung.
Das Pianocordersystem wurde später von Yamaha übernommen und
auch diese MIDI- Files sind spielbar.
Ich selber möchte eigentlich keinen PC bei meinem Pianocorder
Vorsetzer deponieren, sondern einfach eine Kassette einlegen und Musik
hören. Hat man Zugriff auf Kassettenbänder von Kollegen und
möchte diese kopieren oder auf den PC laden, so kann folgende
Schaltung nachgebaut werden. Mit dieser einfachen Schaltung, welche
natürlich entsprechend angepasst oder erweitert werden kann, ist
folgendes zu bewerkstelligen:
• Ueberspielen von einem Kassettengerät auf ein
anderes, wenn zwei vorhanden sind.
• Ueberspielen von einem Kassettengerät auf den
PC und zurück.
• Aufnahmen von MIDI- Files aus dem Internet, welche
mit dem Computerprogramm von Mark Fontana decodiert wurden auf das
Kassettengerät.
Verbindet man den NF-Eingang mit dem Line Ausgang des PC so misst man
ca. 150 mV Wechselspannung am Eingangskondensator. Diesen Wert
sollte man erreichen mit den Windowseinstellungsangaben von Mark
Fontana, seinem entwickelten Programm Winamp und Windows XP. Da der
Eingang dieser Schaltung mono ist, verwendet man nur einen Draht.
Drähte nicht zusammenschalten, dies ergibt eine Dämpfung!
Möchte man ganz sicher sein, dass der Pegel in Ordnung ist, so
betrachtet man das Ausgangssignal mit einem KO und es sollte aussehen
wie auf dem Oszillogramm.
Das Problem 200 Hz Ton
Wie in meinem letzten Artikel beschrieben besteht das Problem, dass die
Magnete, welche mit 200 Hz angesteuert werden, diesen Ton hörbar
machen, wenn die Tasten auf die Filzdruckscheiben gedrückt werden.
Ich habe darum bei meinem Klavier auf folgende Justierung geachtet: Die
Spieltiefe an die obere Grenze (10mm) genommen und die Ueberhöhung
der schwarzen Tasten auf genau 2mm eingestellt. Mit diesen
Einstellwerten ist dieses Problem weitgehend eliminiert. Betreibt man
den Vorsetzer an einem pneumatischen Klavier mit Untereinbau bei
welchem sich die Tasten bewegen ist die Justierung der Tasten besonders
heikel, da die Tasten hinten auch einen Anschlag besitzen. Hier muss
die Taste auf der Vorderdruckscheibe und hinten genau gleich stark
aufliegen.
Schlussbetrachtung
Ich bin mit diesem Marantz System sehr zufrieden. Musik gibt es in
grosser Menge dazu, doch eigentlich gefallen mir hauptsächlich
Operettenmelodien und alte Schlager und gerade in dieser Hinsicht ist
das Angebot eher klein. Für Freunde amerikanischer Musik,
Musicals, Jazz und klassische Titel ist dieses System sehr
empfehlenswert. Für Spezialisten ist es auch möglich ein
Musikstück nach seinem eigenen Geschmack Note für Note in ein
Musikprogramm einzugeben. Das funktioniert sicher, doch klingen
würde das dann eher „unkünstlerisch“ und man wäre
vermutlich enttäuscht. Doch erlauben sie mir einen Jules Verne
Ausblick: vielleicht erfindet in Zukunft jemand ein Programm mit einem
Algorithmus mit dessen Hilfe man selbst erstellte Midi Files bearbeiten
kann damit es klingt, wie wenn Arthur Rubinstein oder Wilhelm Backhaus
oder andere Pianisten am Klavier sitzen würden, wer weiss !
Wenn jemand Ersatzteile für seinen Pianocorder sucht, kann er sich
bei mir melden, ev. kann ich den Wunsch weiterleiten.
März 2013, Hans Kunz.